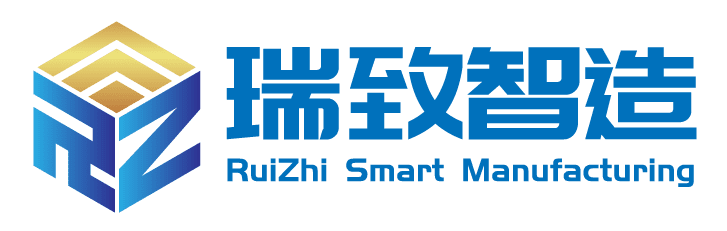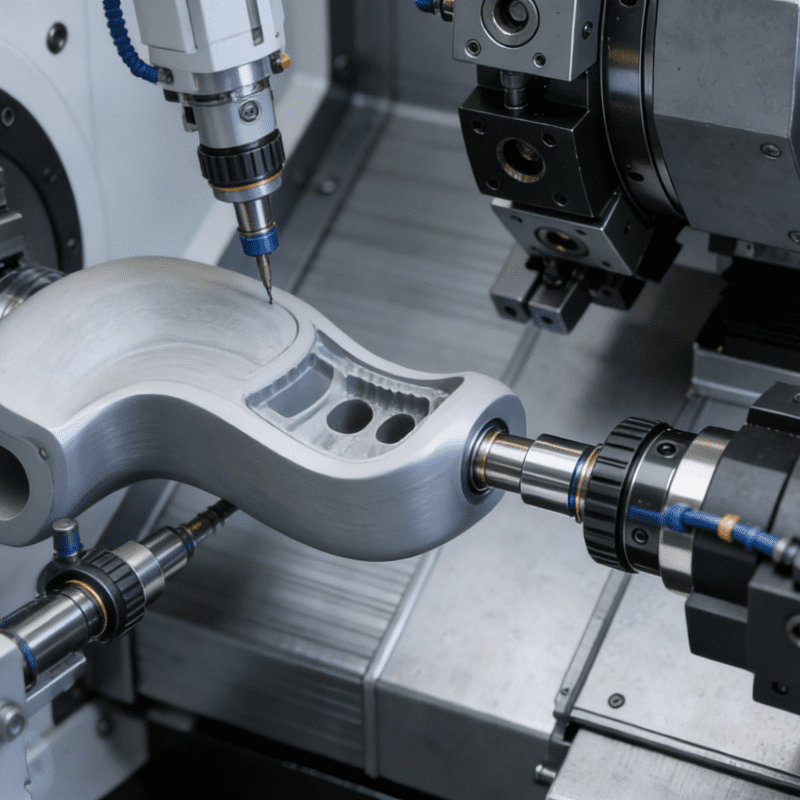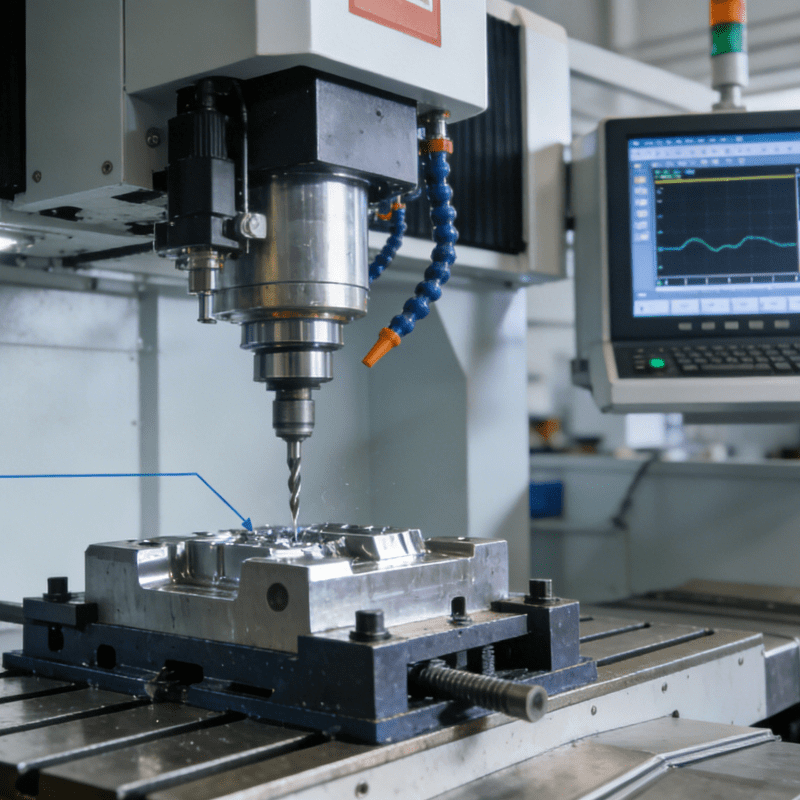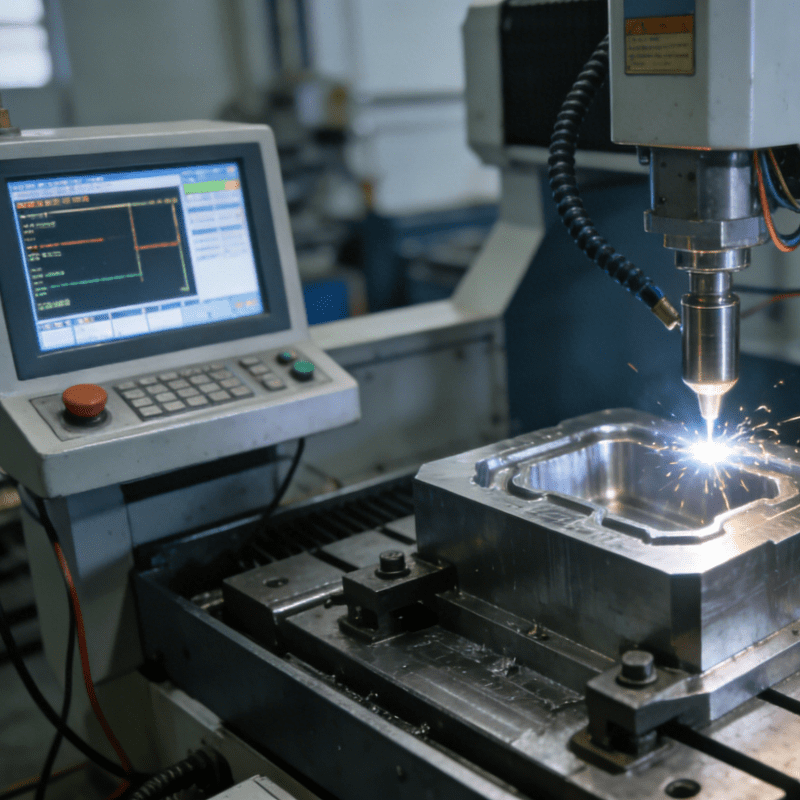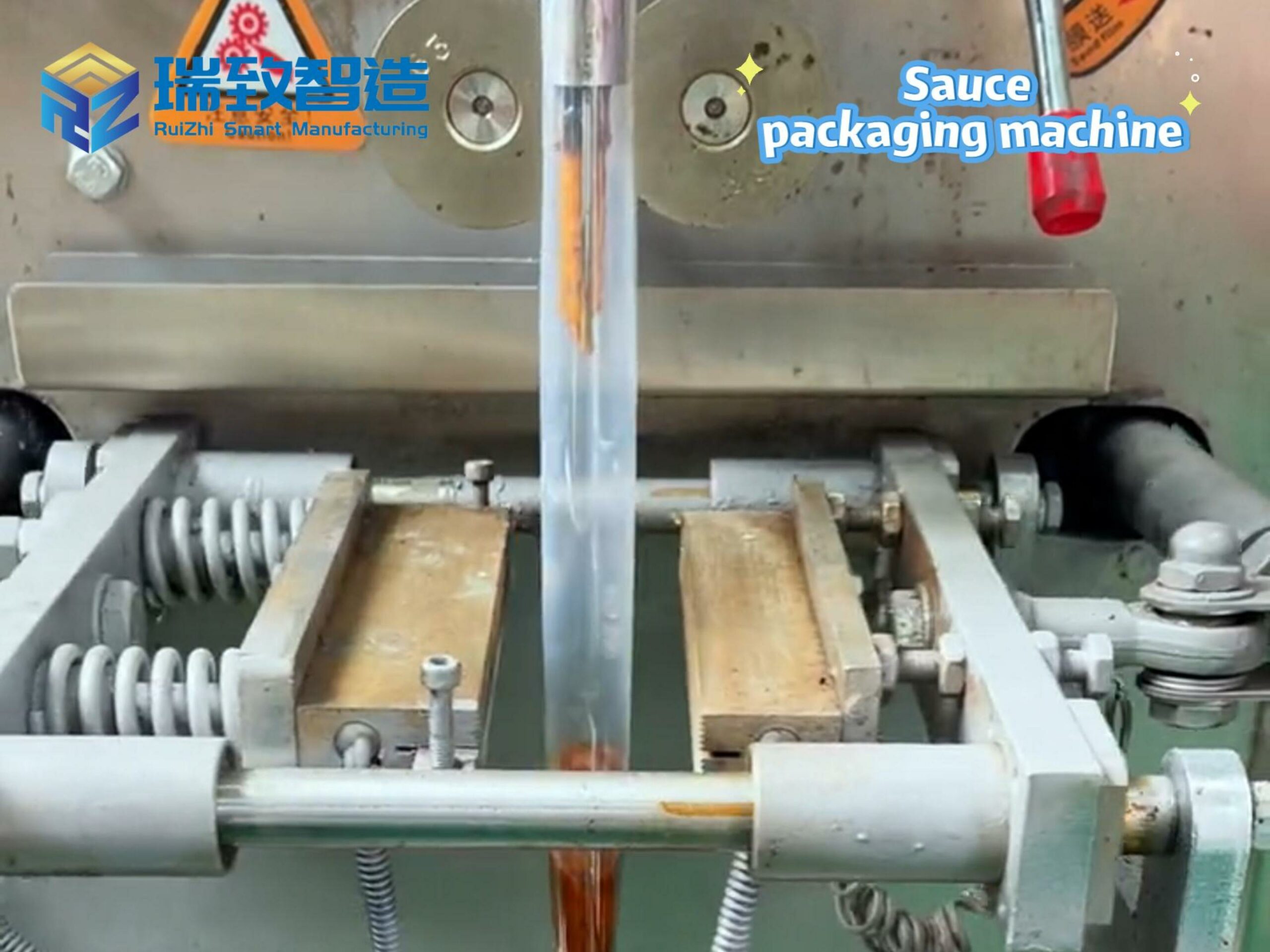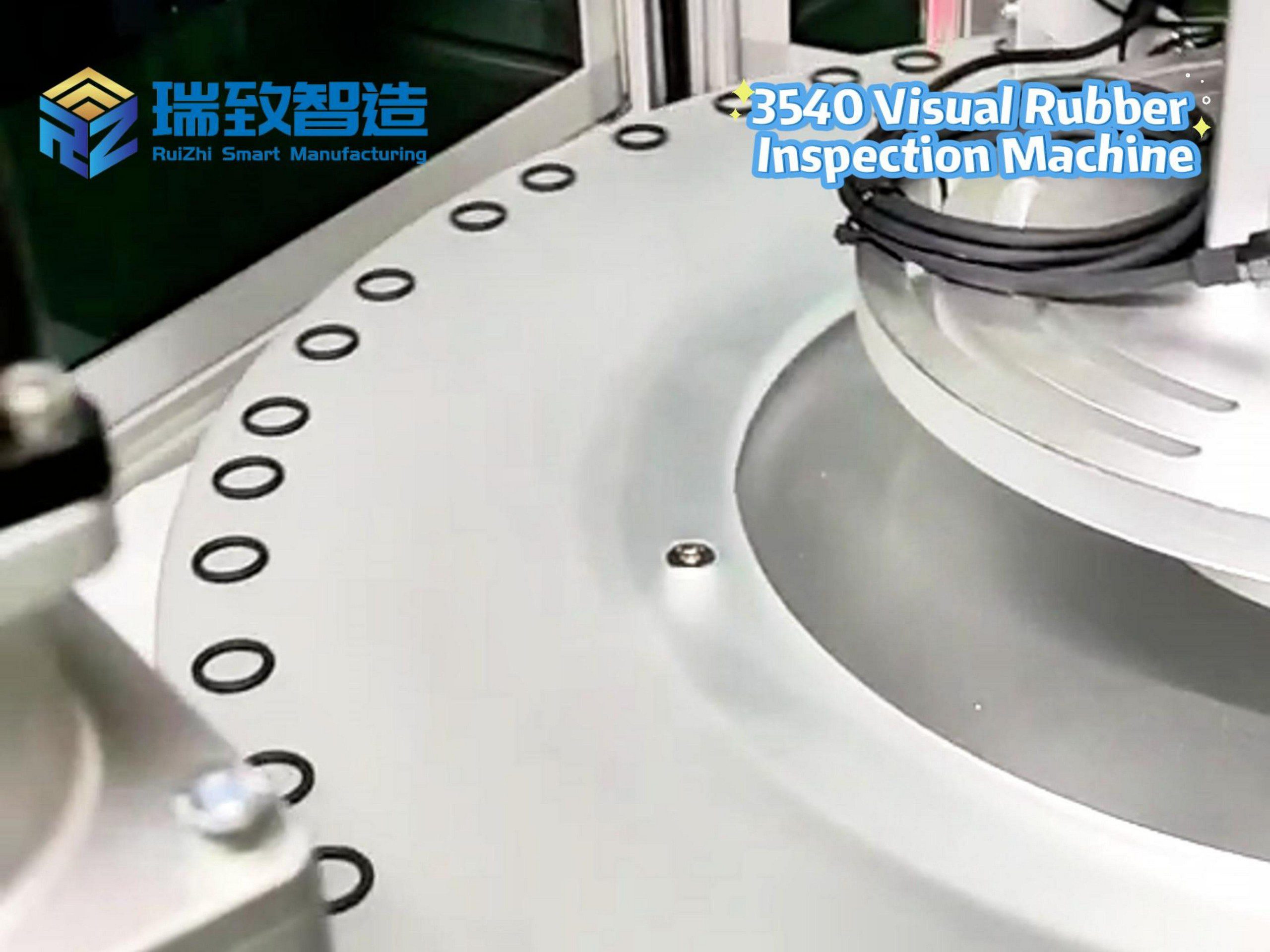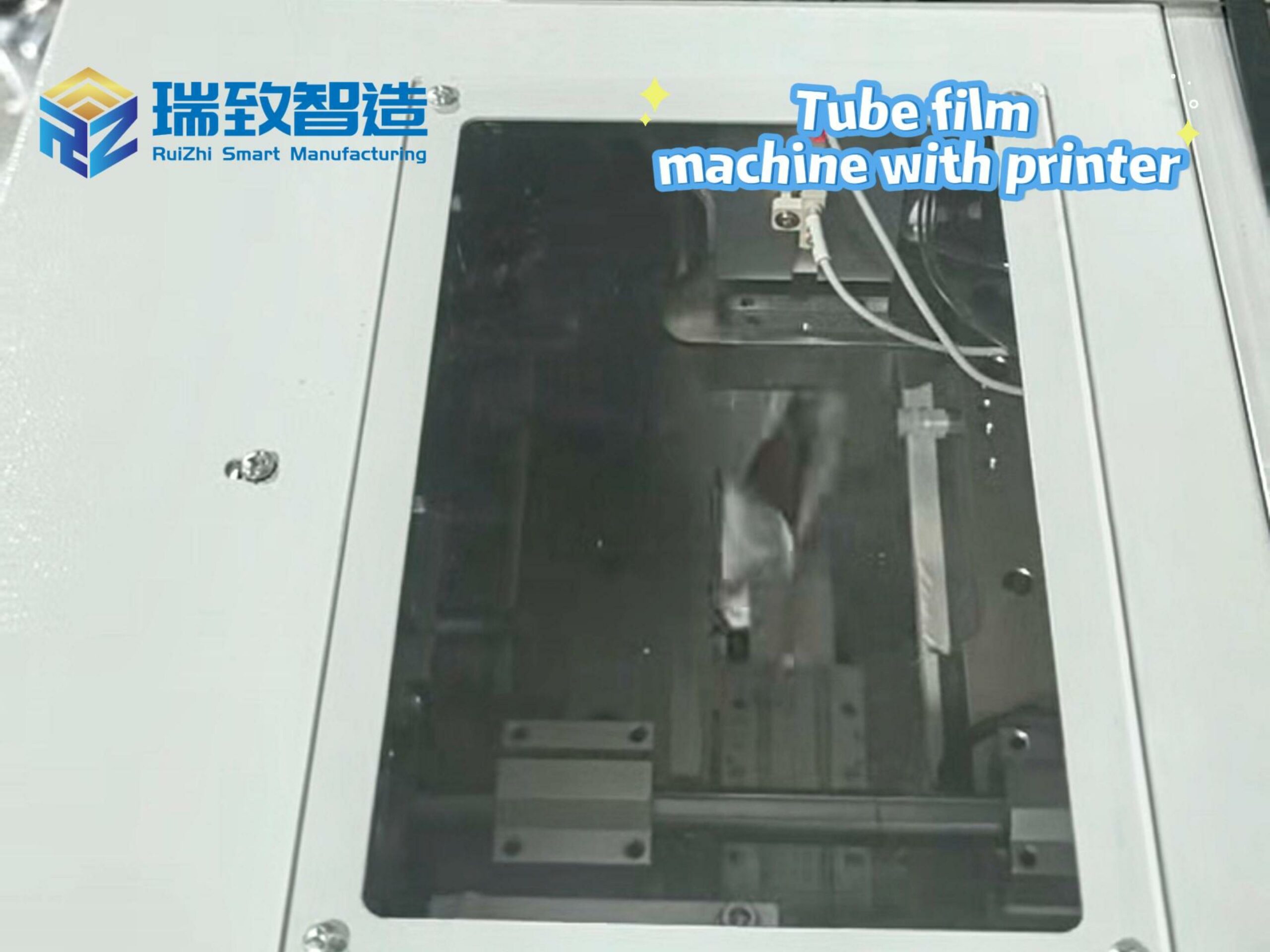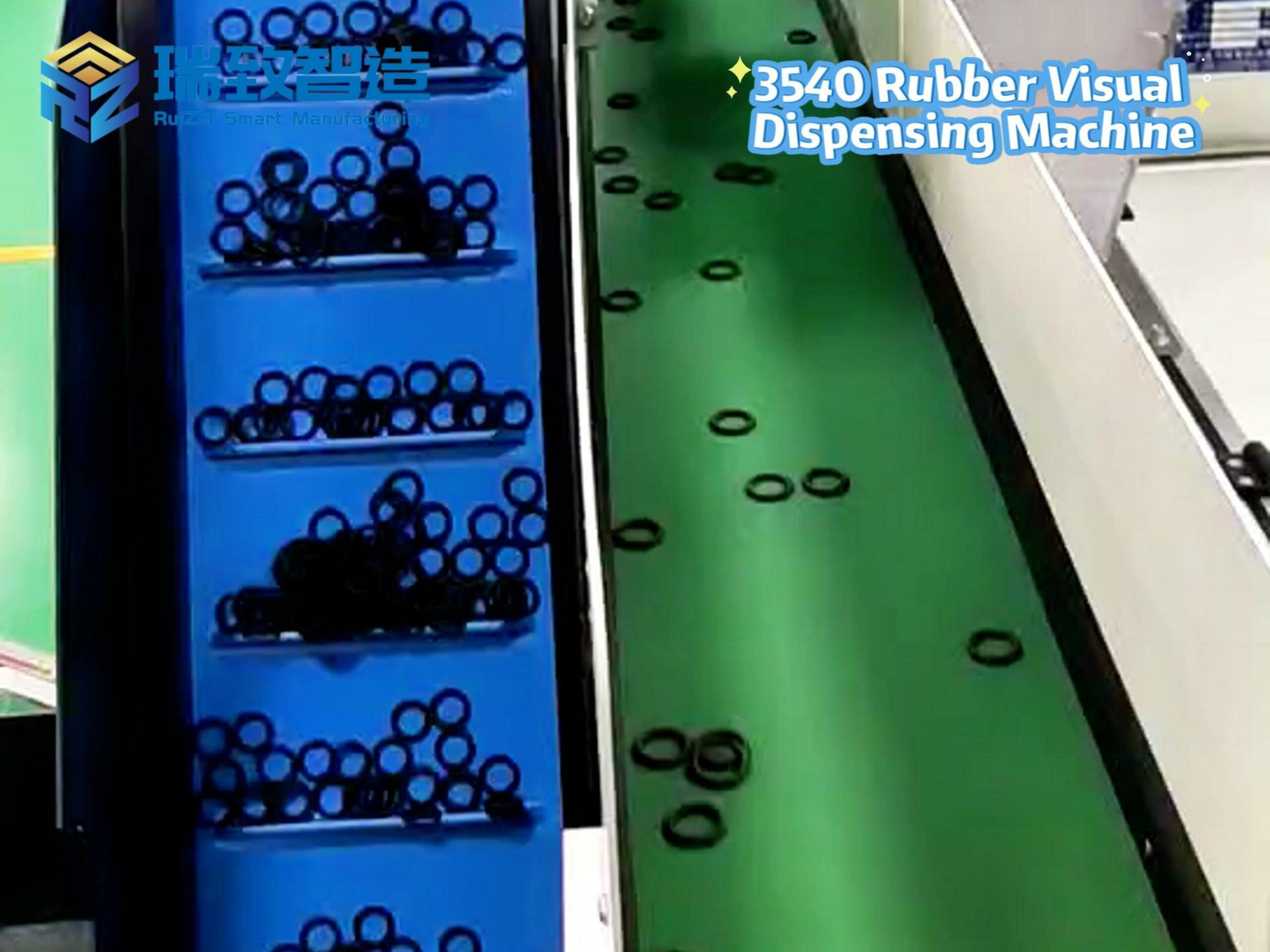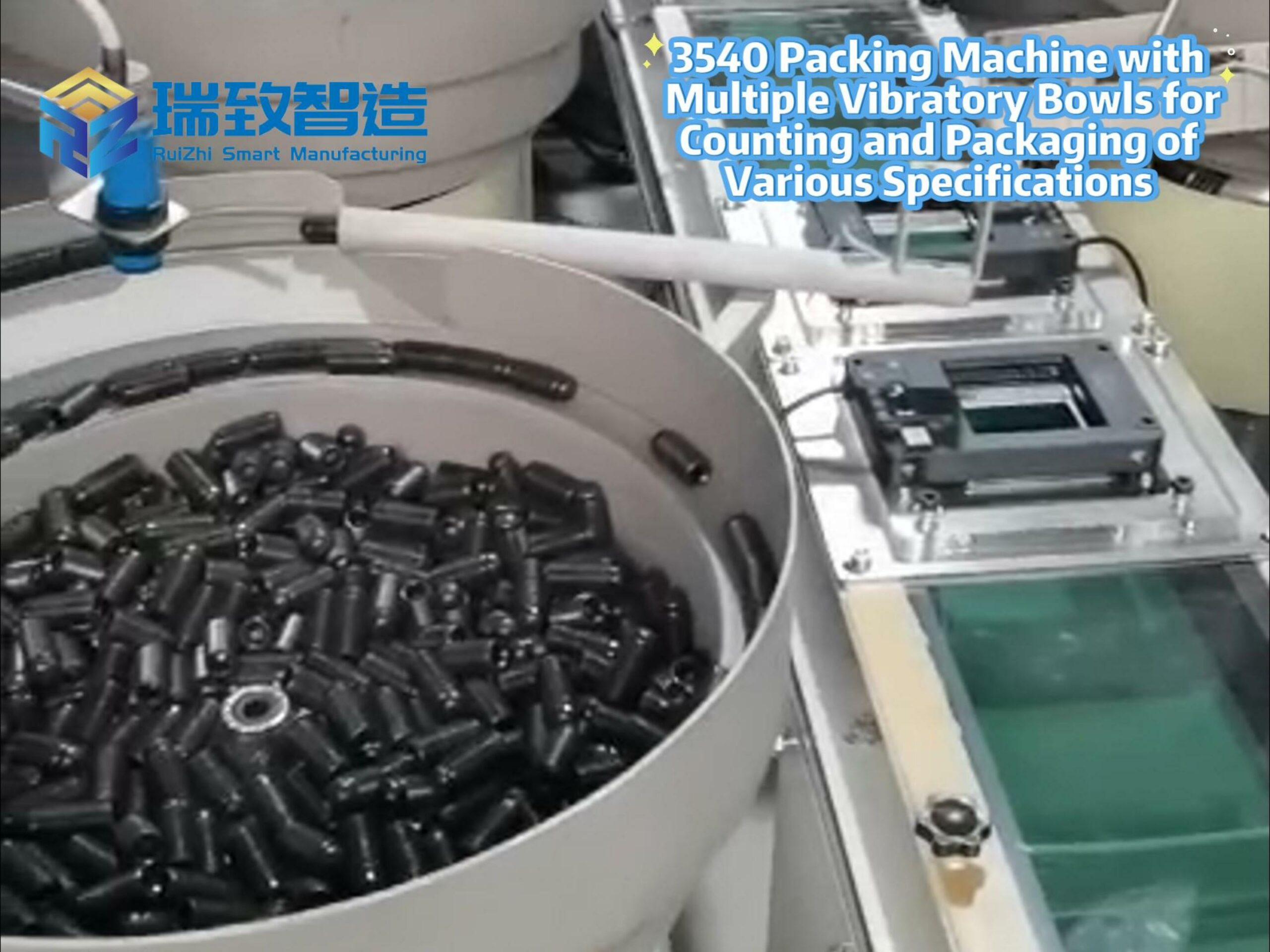Table of Contents
ToggleFrom Automation to Exclusion: Rethinking AI Efficiency in the Global South

Ein transformierter öffentlicher Dienst: Der Fall Hongkong
Während intelligente und industrielle Automatisierung die globale Arbeitswelt verändern, steht Hongkong an der Spitze eines radikalen Experiments zur Anwendung von KI im öffentlichen Dienst. Der Vorstoß der Stadt, KI-gestützte Lösungen einzusetzen, zielt darauf ab, die Effizienz der Regierung zu steigern und dem Haushaltsdruck zu begegnen. Er verdeutlicht aber auch einen beunruhigenden Trend: Automatisierungsgeräte und algorithmische Systeme könnten die Ungleichheit verschärfen – insbesondere in Regionen des Globalen Südens, in denen die digitale Infrastruktur und der Arbeitsschutz unzureichend sind.
Laut einem CNA-Bericht vom Februar 2025 plant Hongkong, KI als Eckpfeiler einer Umstrukturierung des öffentlichen Dienstes zu nutzen. Im Zuge dessen werden bis 2027 rund 10.000 Stellen abgebaut, was einem jährlichen Personalabbau von 21 TP3T entspricht. Die Strategie basiert auf dem Einsatz intelligenter Automatisierung, um die Qualität des öffentlichen Dienstes aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Kosten zu senken. So nutzt beispielsweise das Census and Statistics Department KI, um früher manuell ausgeführte Verifizierungsaufgaben zu automatisieren. Um diesen Wandel zu unterstützen, hat die Stadt über 11 Milliarden HK$ (1,4 Milliarden US$) für KI-Innovationen bereitgestellt, darunter Mittel für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und einen Technologiefonds für Zukunftsbranchen. Diese Investition unterstreicht, dass Automatisierungsgeräte und KI zunehmend als Allheilmittel für Governance-Herausforderungen angesehen werden. Gleichzeitig wirft sie aber auch die dringende Frage auf, wer die Hauptlast für „Effizienz“ trägt.
Ein globales Muster: KI als Bewerter, nicht nur als Ausführender
Hongkongs Ansatz spiegelt einen breiteren globalen Trend wider: Von Indonesien bis Subsahara-Afrika automatisiert künstliche Intelligenz nicht nur Aufgaben, sondern bewertet auch den Wert menschlicher Arbeitskräfte. In Pilotregionen der südlichen Hemisphäre werden Beamte nun von KI-Systemen bewertet, die Kennzahlen zur Zusammenarbeit, E-Mail-Muster und Aufgabenergebnisse analysieren, um redundante Rollen zu empfehlen. Diese algorithmische Bewertung ähnelt Initiativen in den USA, wo das Energieministerium KI einsetzt, um Beschaffungsanomalien zu kennzeichnen, und in Südkorea, wo KI zur Bewertung der öffentlichen Gesundheitsversorgung getestet wurde. In vielen afrikanischen und südostasiatischen Ländern setzen geberfinanzierte Projekte auf algorithmische Bewertungen, um die Kontinuität des lokalen Personals zu bestimmen – alles unter dem Deckmantel der Effizienz der industriellen Automatisierung.
Die verzerrte Linse der Effizienz
Oberflächlich betrachtet erscheint das Versprechen objektiver Bewertungen durch KI verlockend. Doch die Gefahr liegt in der Linse selbst: KI-Systeme, geprägt von den Vorurteilen ihrer Entwickler, berücksichtigen oft nicht den differenzierten Wert von Rollen, die auf emotionaler Arbeit, präventiver Pflege oder kulturellem Kontext basieren – Rollen, die überproportional von Frauen und marginalisierten Gruppen besetzt werden. Automatisierungsgeräte können zwar Ergebnisse erfassen, aber sie können die Absicht hinter einem Engagement in der Gemeinde oder die in diplomatischen Verhandlungen erforderliche Diskretion nicht messen. Wenn „Effizienz“ durch das definiert wird, was Algorithmen quantifizieren können, wird die unsichtbare Arbeit, die den sozialen Zusammenhalt aufrechterhält, entbehrlich.
Ein drohendes soziales Risiko im globalen Süden
Das Risiko ist besonders akut in Entwicklungsländern, wo KI-bedingte Arbeitsplatzverluste die Arbeitslosigkeit in Volkswirtschaften mit wenigen alternativen Möglichkeiten verschärfen können. Die Kluft zwischen den digitalen Kompetenzen führt dazu, dass viele Arbeitnehmer schlecht auf den Übergang in Positionen vorbereitet sind, die den Umgang mit intelligenten Automatisierungstools erfordern. Gleichzeitig verschärft die ungleiche digitale Infrastruktur die Ungleichheit. Ruanda bietet mit seiner Politik obligatorischer Bürgerkonsultationen und KI-Kompetenzprogrammen für staatliche Automatisierungsprojekte einen Hoffnungsschimmer – ein Modell, das inklusive Regierungsführung gegenüber blinder Technologieübernahme priorisiert.
Eine Regierungsführung, die die Menschenwürde schützt
Der Kern des Problems liegt in drei fehlenden Governance-Grundpfeilern: Erklärbarkeit (damit Mitarbeiter verstehen, warum sie als „minderwertig“ eingestuft werden), menschliche Entscheidungsfindung (um Mitgefühl und Kontext zu ermöglichen) und öffentliche Transparenz (um unabhängige Kontrolle zu gewährleisten). Ohne diese Grundpfeiler werden Automatisierungsanlagen und KI zu Werkzeugen stiller Ausgrenzung – Mitarbeiter werden nicht entlassen, sondern von Systemen, die Effizienzkennzahlen über den menschlichen Kontext stellen, „aussortiert“. Im Globalen Süden, wo Widerstand gegen Automatisierung oft als „fortschrittsfeindlich“ dargestellt wird, schafft dies ein Klima, in dem ethische Reflexion an den Rand gedrängt wird.
Kontextbezogene Governance, keine importierten Frameworks
Die Lösung besteht nicht darin, KI abzulehnen, sondern ihren Einsatz in einer kontextbezogenen Governance zu verankern. Multidisziplinäre Teams müssen Systeme mit integrierten Ethikbeauftragten und integrierter Prüfbarkeit gemeinsam entwickeln. Entscheidend ist, dass die Rahmenbedingungen für intelligente und industrielle Automatisierung an die lokalen sozialen Strukturen angepasst und nicht aus dem Globalen Norden importiert werden. Die meisten Entwicklungsländer sind KI-Nutzer, nicht Entwickler, was sie anfällig für Verzerrungen in ausländischen Systemen macht. Gleichzeitig müssen Umschulungsprogramme skaliert werden, um Arbeitnehmer zu unterstützen, die durch Automatisierungsanlagen ihren Arbeitsplatz verloren haben, und so eine inklusive Teilhabe an der digitalen Wirtschaft zu gewährleisten.
Was für ein System bauen wir?
Wenn KI zum Schiedsrichter über den Wert des Menschen wird, wird Schweigen zur Komplizenschaft. Es reicht nicht aus, effiziente Systeme zu bauen; wir müssen Systeme schaffen, die die Bedeutung menschlicher Arbeit – mit ihrer emotionalen Intelligenz, ihren kulturellen Nuancen und ihrem kontextuellen Wissen – anerkennen. Die Herausforderung für den Globalen Süden besteht darin, das Potenzial intelligenter und industrieller Automatisierung zu nutzen, ohne die Würde derjenigen zu opfern, die seine Gesellschaften antreiben. Letztendlich lautet die Frage nicht, wie KI funktioniert, sondern wie sie für alle nutzbar gemacht werden kann.